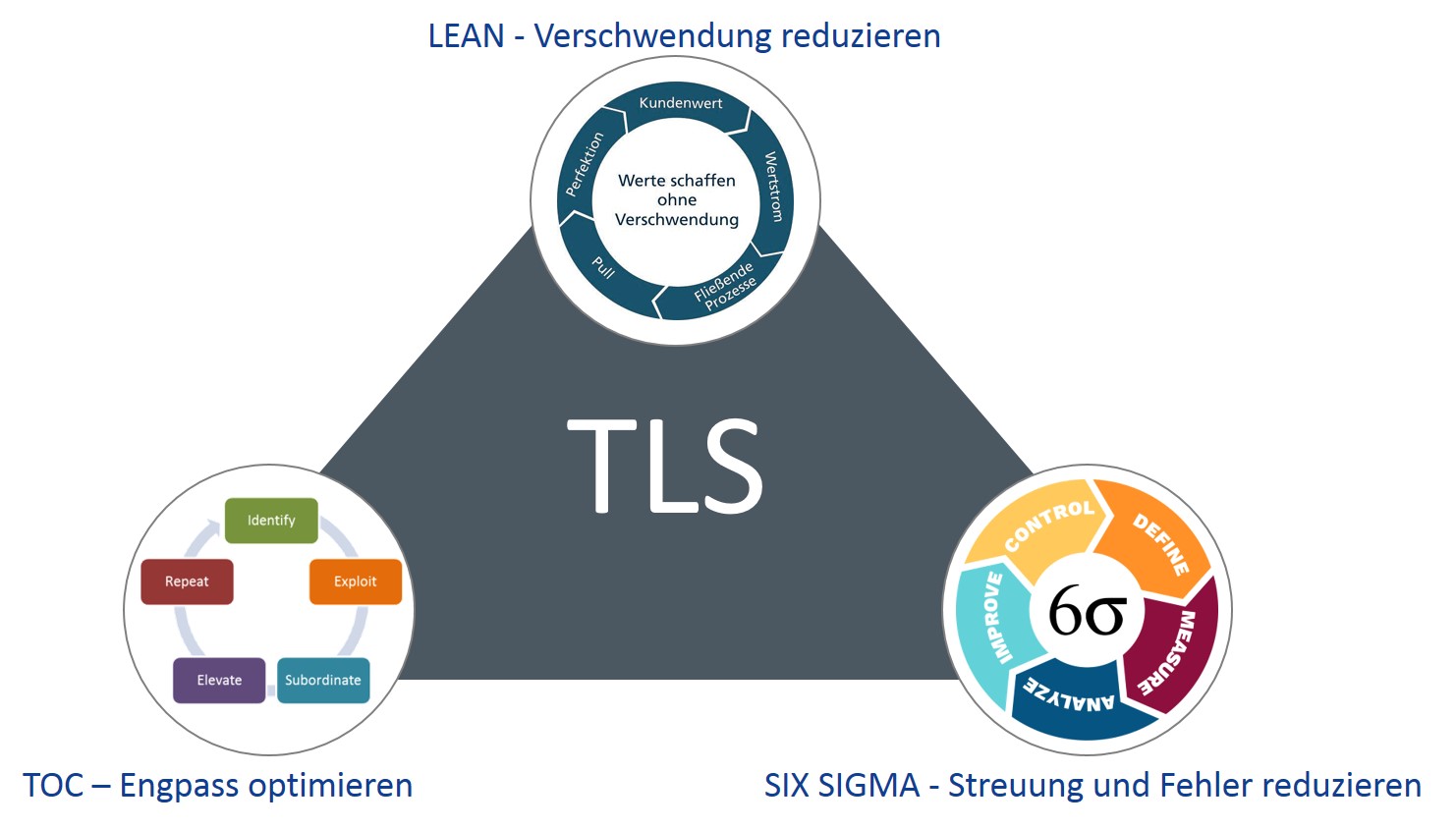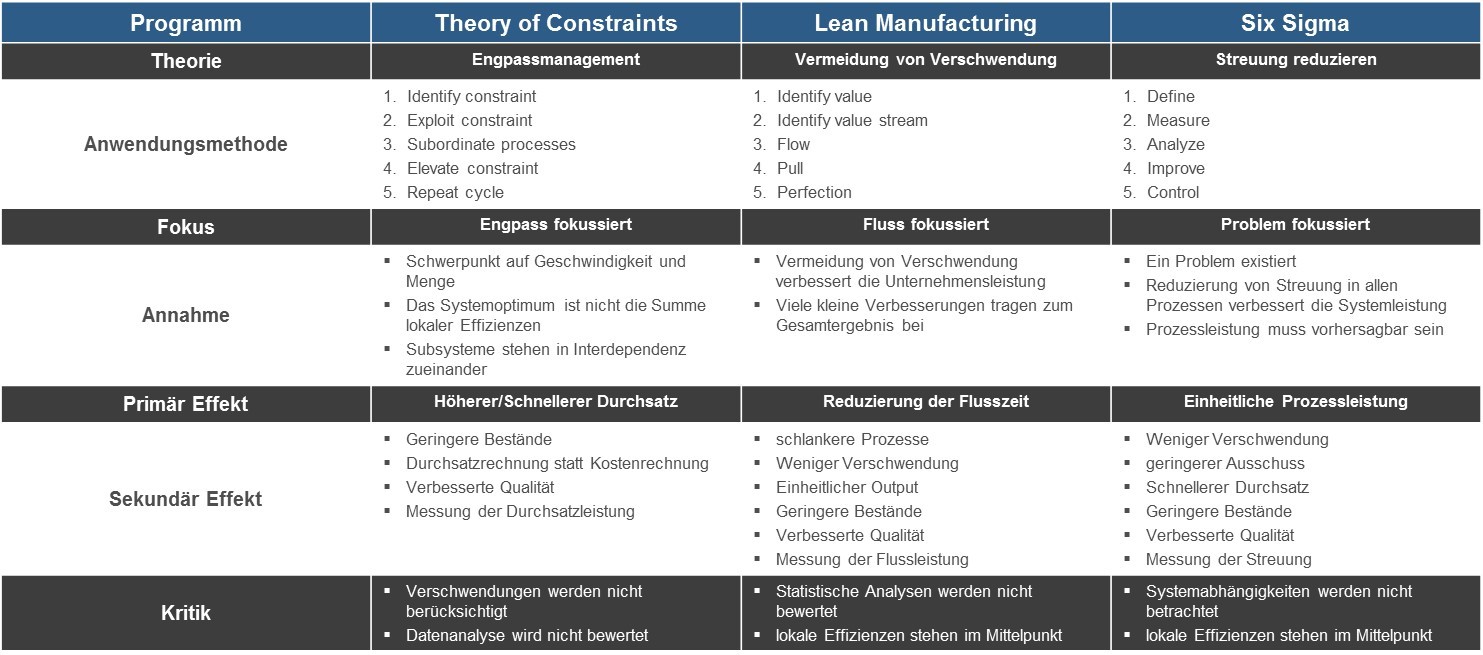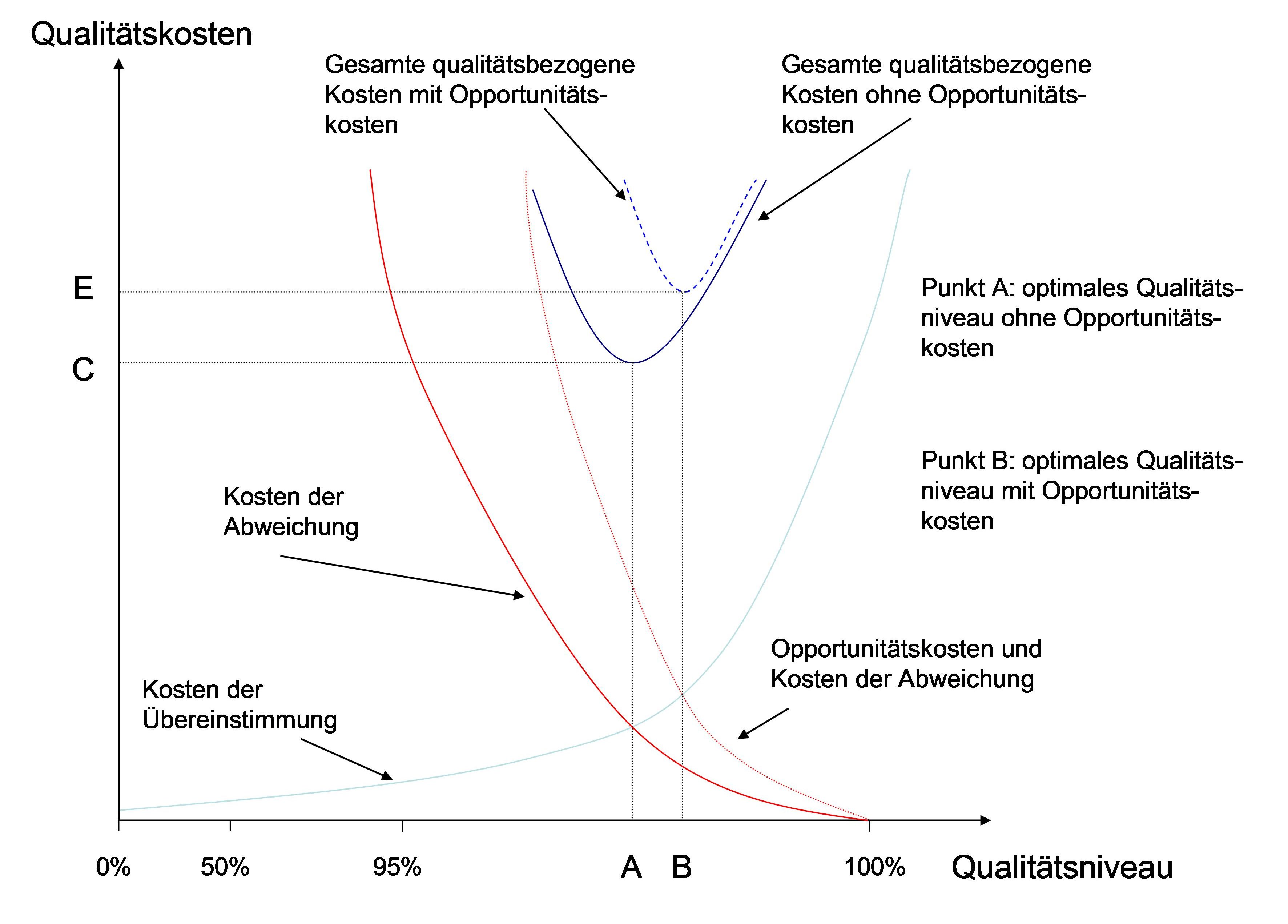Industrie 4.0 – Eine Einschätzung
Deutschland ist einer der konkurrenzfähigsten Industriestandorte weltweit. Die Spezialisierung liegt dabei im Bereich der Forschung, Entwicklung und Fertigung von innovativen Produktionstechnologien und Produkten. Dieser Ansatz wird ebenfalls konsequent in der heimischen Industrieproduktion durch innovative Technologien verfolgt. Dabei bildet das produzierende Gewerbe das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Der globale Wettbewerb in der Produktionstechnik nimmt immer weiter zu. Insbesondere die Konkurrenz aus Asien sowie die Möglichkeiten der Digitalisierung setzen die deutsche Industrie weiter unter Druck. Dabei spielen neben der Niedriglohn-Produktion immer mehr die Anforderungen der vierten industriellen Revolution eine entscheidende Rolle. Mit der steigenden Dynamik und Komplexität der Industrieproduktion werden zunehmend individuelle und innovative Produkte bei gleichbleibenden Preisen durch die weltweiten Märkte gefordert.
Die Herausforderungen
Neben der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderung steht die gesamte Branche vor einem wegweisenden technischen Meilenstein – die vierte industrielle Revolution begründet durch das Internet der Dinge und Dienste durch autonome eingebettete Systeme, die drahtlos untereinander kommunizieren und mit dem Internet vernetzt sind. Auch zukünftig will Deutschland seine führende Position im Bereich der Produktionstechnik behaupten und den Wandel zur Industrie 4.0 federführend beschreiten. Im Rahmen der Industrie 4.0 werden die Unternehmen zukünftig ihre Fabriken sowie die Lieferketten intelligent miteinander vernetzen. Über sogenannte Smart Factorys und Cyber-Physikalische Produktionssysteme (CPPS) entsteht eine völlig neue Produktionslogik. Dabei adressiert das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 alle großen aktuellen und zukünftigen Herausforderungen – die Wettbewerbsfähigkeit im Rahmen der Digitalisierung und des Produktionsstandortes Deutschland, die Etablierung von Ressourcen- und Energieeffizienten Produkten und Produktionsbedingungen, die Flexibilisierung der Produktion, Individualisierung von Kundenanforderungen, neue digitale Geschäftsmodelle sowie den demografischen Wandel der Gesellschaft.
Status Quo
Die Herausforderungen und Potentiale der vierten industriellen Revolution wurden bereits 2006 durch die Bundesregierung adressiert. Im Rahmen der Hightech-Strategie wurden unterschiedliche Förderprogramme und Forschungsinitiativen gestartet. Neben der Definition von Zielen und Strategien wurden zentrale Umsetzungsroadmaps entwickelt. Der Transfer aus der Forschung in die Praxis stellt die aktuellen Herausforderungen dar. Der Wandel der Industrie wird aufgrund der vorliegenden Komplexität einen evolutionären Charakter haben. In diesem Zusammenhang besteht die aktuell größte Herausforderung. Den revolutionären Charakter der Veränderung in Bezug auf Geschwindigkeit und Innovation in einem effektiven und effizienten Transformationsprozess zu kanalisieren. Aufgrund der Komplexität und Tragweite der Veränderung ist es notwendig, dass die erzielten Forschungsergebnisse im Unternehmenskontext in einem spezifischen, iterativen Entwicklungsprozess adressiert werden. Dabei ist der Industrie 4.0 Reifegrad einer Organisation in Bezug auf die Umsetzungsroadmap wiederkehrend zu ermitteln.
In den letzten Jahren wurden die Industrie 4.0-spezifischen Initiativen in den Unternehmen deutlich gesteigert. Parallel hat die Bundesregierung auf infrastruktureller Ebene das Fundament weiter ausgebaut. Insbesondere Fragen des mobilen Internets, der Regulierung von Daten sowie allgemeine rechtliche Fragen stellen wesentliche Erfolgsfaktoren in Bezug auf die erfolgreiche Gestaltung der industriellen Transformation dar. Dieser Umstand wird in der aktuellen Debatte bzgl. des Ausbaus des neuesten Standards im Bereich des mobilen Internets deutlich. Neben der Industrie 4.0 fordern viele weitere Branchen den schnellen und unbürokratischen Ausbau der Infrastruktur in Deutschland. Die Infrastruktur bildet das Fundament der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie.
Ein Ausblick
Das Zukunftsprojekt Industrie 4.0 hat für die deutsche Industrie und den Wirtschaftsstandort Deutschland ein sehr großes Potential die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Die Umsetzung stellt sowohl für die Unternehmen als auch die Bundesregierung eine große Herausforderung dar. Der Erfolgt kann nur durch eine enge Zusammenarbeit zwischen beiden Interessenvertretern erzielt werden. Im Rahmen der Industrie 4.0 hat Deutschland die Möglichkeit die Technologieführerschaft in diesem Bereich zu erlangen. Als Leitanwender definieren die beteiligten Unternehmen die Standards und Normen in diesem Zukunftssegment und folglich die Vormachtstellung im Markt. Die Umsetzung und Transformation innerhalb der vierten industriellen Revolution werden weiter an Fahrt und Dynamik gewinnen. Der Ausgang ist noch völlig offen. Der Wirtschaftsstandort Deutschland hat alle Voraussetzung dieses zukunftsträchtige Projekt erfolgreich zu gestalten.